Archiv
zurück zu den neuesten Nachrichten
Im April 2022 erschien ein wichtiger Beitrag zu gebietseigenem Saatgut in der Zeitschrift „Naturschutz und Landschaftsplanung“. Unter dem Titel „Gebietseigenes Saatgut – Chance oder Risiko für den Biodiversitätsschutz?“, stellen die Autoren des Artikels die ausschließliche Ausrichtung des am BfN in Ausarbeitung befindlichen Leitfadens auf den botanischen Artenschutz infrage und fordern eine stärke Berücksichtigung der Wirkung von Ansaaten auf die Tierwelt.
Mai/Juni 2022: Naturgarten e.V. – Regionaltage 2022 „Naturnahes Öffentliches Grün“
Der Naturgarten e.V. bietet von Ende Mai bis Ende Juni wieder seine Praxisseminare „Naturnahes Öffentliches Grün“ an fünf verschiedenen Standorten an. Zielgruppe sind Planer*innen, Bauhöfe, Gärtner*innen und Kommunale Vertreter.
Juni 2021: „Die schönste Streuobstwiese wächst in Hundsgrün“ – Mitgliedsbetrieb Baumschule am Jägerhaus prämiert
Wir freuen uns mit Frau Fuhrmann, die VWW-Regiogehölze produziert, über die Auszeichnung ihrer besonders artenreichen Streuobstwiese, die zukünftig auch der Erzeugung von Heumulch dienen soll.

Foto: Eckhard Sommer
Juni 2021: Naturgarten e.V. – Regionaltage 2021 wieder in Präsenz
Der Narturgarten e. V. bietet am 16.06.2021 einen Regionaltag in Fridolfing an.
Mai 2021: Der YouTube-Kanal des VWW ist online.
Auf unserem Kanal möchten wir Videos rund um das Thema regionale Wildpflanzen mit euch teilen.
Mit einem Klick auf das YouTube-Logo gelangt man zum Kanal und unserem ersten Video aus der Kategorie Wildpflanzentipps.![]()
April 2021: Qualitätsprogramm VWW-Regiostauden® geht an den Start!
Betriebe, die sich für den Einstieg in die Produktion von zertifizierten heimischen Stauden interessieren, können sich gerne bei der Geschäftsstelle melden.
Das Regelwerk für die Zertifizierung von VWW-Regiostauden® findet man hier:

Mai-Juni 2021: Naturgarten e.V. – Regionaltage 2021
Der Naturgarten e.V. bietet wieder Naturgarten-Praxisseminare an. Bei den Regionaltagen für naturnahes öffentliches Grün, erfährt der Teilnehmer warum und wie sich heimische Blumenwiesen und Wildblumensäume planen, anlegen und pflegen lassen. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter dem nachfolgenden Link.
Wir wünschen den Teilnehmern viel Spaß bei den Praxisseminaren!
Januar 2021: Neuer Webshop der Firma Bauer Courth
Die Bauer Courth Wild.Saat.Gut vertreibt regionales Saatgut von Wildblumen und –gräsern. Ab sofort kann man regionales Wildsaatgut über den neuen Onlineshop www.wild-saat-gut.de, der speziell für Privat- und Kleinkunden konzipiert ist, beziehen.
November 2020: Ab sofort bietet der Integrationsbetrieb Haseler Mühle hochwertige Wildpflanzensaatgutmischungen auch in Kleinpackungen für Gärten und den Siedlungsbereich an. Das Angebot unseres Mitgliedsbetriebes im Saarland finden Sie hier.

Oktober 2020: Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage unter den Nutzern heimischen Pflanzenmaterials im Osten der USA zeigen, dass dort ähnliche Schwierigkeiten bestehen wie in Deutschland und ganz Europa
Ed Toth, Director der Mid-Atlantic Regional Seed Bank in New York schreibt:
Aufregende Neuigkeiten mitzuteilen: Die Ergebnisse unserer Umfrage unter Hunderten von Verwendern von einheimischem Pflanzenmaterial im Osten der Vereinigten Staaten sind vollständig!
Im Jahr 2018 führte die Regionale Saatgutbank des mittleren Atlantiks (MARSB) die erste Umfrage unter Anwendern von einheimischem Pflanzenmaterial (NPM) aus dem gesamten Osten der Vereinigten Staaten durch, um die Trends bei der Verwendung und Verfügbarkeit von NPM im Osten der USA besser zu verstehen.
Wir erhielten 760 Antworten. NPM-Anwender aus allen Bundesstaaten östlich des Mississippi waren vertreten und es zeigten sich starke Muster. Die Befragten äußerten eine Präferenz für lokale Ökotypen (74%) und fast kein Interesse an Kulturvarietäten (0,3%). Die Befragtennannten die kommerzielle Verfügbarkeit als größtes Hindernis für die Verwendung lokaler Ökotypen. Zweiundneunzig Prozent der Befragten verwenden einheimisches Saatgut, und diejenigen, die lokale Ökotypen bevorzugen, kaufen weiter entfernt ein, als es ihrem Konzept von Regionalität entsprechen würde. So war beispielsweise der am günstigsten gelegene Saatgutlieferant im Durchschnitt 363 Meilen und der zweitbeste 805 Meilen entfernt. Befragte, für die „heimisch“ als im Bundesstaat gelegen gilt, kaufen ihr Saatgut in 85 Prozent der Fälle außerhalb des Bundesstaates. Dreiundachtzig Prozent wären bereit, einen Aufpreis zu zahlen, um lokale Ökotypen zu erhalten. Dieser Grad an mangelnder kommerzieller Verfügbarkeit versetzt die Befragten in die Lage, ständig nicht-lokale NPMs in ihre Standorte einzubauen, wodurch das Risiko des Scheiterns von Projekten und/oder der Degradierung von Naturgebieten besteht.
In den Antworten auf die Umfrage werden mögliche Lösungen vorgeschlagen, darunter die Schaffung eines Online-Marktplatzes, die Erhebung von Prämien für lokale Ökotypen und die Bereitstellung technischer Unterstützung. Die Autoren ermutigen auch Beschaffungsreformen und sehen in der Entwicklung eines Netzwerks aktiver Saatgutbanken den wesentlichen ersten Schritt zum Aufbau einer robusten Lieferkette für einheimisches Pflanzenmaterial, um den Bedürfnissen des Ostens der USA gerecht zu werden. Schließlich erwarten die Befragten, dass ihre Nachfrage nach NPMs von Jahr zu Jahr steigen wird, was die Wichtigkeit unterstreicht, diese Probleme jetzt anzugehen. Den vollständigen Text finden Sie hier
März 2020: Der Wildblumen-Shop der Naturgartenvielfalt ist online!
Unter www.naturgartenvielfalt.de/wildblumen-shop/ finden Sie regionale Wildblumenmischungen für unterschiedliche Standorte und Einsatzmöglichkeiten aus zertifizierten VWW-Regiosaaten® auch in gartengerechten Kleinpackungen. Zum Angebot der erfahrenen Naturgärtnerin Kerstin Lüchow gehören außerdem Beratung, Vorträge und wunderbare Naturfotos. Ein Besuch der schön gestalteten Website lohnt sich auf jeden Fall.
Am 10. Februar 2020 fand die formelle ENSPA-Gründungsveranstaltung an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein (Österreich) statt (ENSPA = European Native Seed Producers Association). Anbauer aus bisher vierzehn europäischen Ländern organisieren sich in dieser Vereinigung, denen hoffentlich weitere folgen werden. Nach Abschluss der offiziellen Registrierung gemäß österreichischem Vereinsrecht werden der VWW und die Rieger-Hofmann GmbH Gründungsmitglieder dieses europäischen Verbandes sein. Wir hoffen auf eine europäische Erfolgsgeschichte!
Januar 2020: Wir möchte auf zwei Beiträge in der Januar-Ausgabe der Zeitschrift Naturschutz und Landschaftsplanung hinweisen: Das Editorial von Prof. Dr. Eckhard Jedicke: „Demonstrieren die Bauern gegen sich selbst? Neustart für die Landwirtschaftspolitik“ und den Panoramabeitrag „Gebietsheimische Arten – VWW warnt vor Verknappung von Wildpflanzensaatgut„ (Quelle: www.nul-online.de).
Dezember 2019: Die nächste VWW-Mitgliederversammlung findet am 18. Mai 2020 in der Nähe von Hamburg statt. Weitere Informationen finden Mitglieder im internen Bereich. Andere Interessierte können sich gerne in der Geschäftsstelle melden.
10 Juli 2019: Wildpflanzenvermehrer in Schleswig-Holstein gesucht!
Gemeinsam mit dem Beratungsring NordOstsee e.V. veranstaltet die Arche Gärtnerei der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein am Mittwoch den 10.07.2019 einen Schnuppertag Wildpflanzen-Vermehrung für Regio-Saatgut von 9-13 Uhr in Eggebek bei Tarp. Da der Markt für Regio-Saatgut rasant wächst, werden händeringend engagierte und versierte Pflanzenbauer gesucht, die abseits des Mainstreams einen neuen Betriebszweig anpacken wollen. Näheres in der Einladung.
Wichtiger Schritt zur Gründung von ENSPA, dem Verband der europäischen Wildpflanzenproduzenten, erfolgreich absolviert. Am 22. Juni 2019 traf sich das Steering Committee bei Cruydt-Hoeck, dem führenden Wildpflanzenproduzenten der Niederlande im schönen Friesland, um die gemeinsam ausgearbeitet Satzung zu verabschieden. Für Februar 2020 ist dann die formelle ENSPA-Gründungsversammlung geplant, zu der wir Wildpflanzenproduzenten aus mindestens 20 europäischen Ländern erwarten.
Juni 2019: Kleinere Mengen gebietseigenes Wildpflanzensaatgut für Ihre Region erhalten Sie jetzt auch über den Lebensinseln-Shop.
Regionales Saatgut für Anssaaten größerer Flächen in der freien Natur erhalten Sie weiterhin über unsere VWW-Mitgliedsbetriebe.

22. Mai 2019: Die VWW-WILDPFLANZENAKADEMIE erfährt großen Zuspruch. Bis heute haben bereits acht Veranstaltungen unter diesem Motto stattgefunden, die allesamt sehr gut besucht waren. Wir werden die Seminarreihe im Herbst mit weiteren Terminen fortsetzen und freuen uns schon darauf! -> zu den Terminen
18.03.2019: Kleinmengen von Wildpflanzensaatgut für Garten und Siedlungsbereich sind jetzt über den Yosana Webshop bestellbar. Regionales Saatgut für die freie Natur erhalten Sie über unsere Mitgliedsbetriebe: https://www.natur-im-vww.de/bezugsquellen/graeser-und-kraeuter/
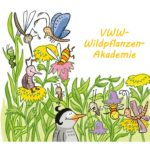
November 2018: VWW STARTET WILDPFLANZENAKADEMIE
Um den Erfolg beim Einsatz von Wildpflanzensaatgut sicherzustellen, bietet der VWW eine Veranstaltungsreihe an Standorten in ganz Deutschland an. Angesprochen sind Praktiker, Planer und Naturschutzmitarbeiter, die im professionellen Rahmen Wiesen und Saumbestände mit Wildpflanzensaatgut anlegen wollen. Im Rahmen der Praxisworkshops geben zahlreiche Spezialisten ihr Wissen aus langjähriger Erfahrung mit Wildpflanzenansaaten weiter.
In den Wintermonaten starten wir mit Vortrags- und Workshop-Blöcken, während in den Sommermonaten an Praxisbeispielen ausgebildet wird.
Weitere Informationen unter: https://www.natur-im-vww.de/service/vww-wildpflanzenakademie
Vom 15. bis zum 19. Mai 2018 fand das Treffen der Europäischen Wildpflanzenproduzenten mit anschließender Exkursion statt
Dabei ging es nicht nur darum, zahlreiche internationale Kollegen persönlich kennen zu lernen und gemeinsam interessante Wildpflanzenbetriebe zu besichtigen. Kern der Veranstaltung war das Treffen am 17. Mai in Blaufelden, bei dem die Voraussetzungen für die Gründung des Verbandes der Europäischen Wildpflanzenproduzenten „ENSPA“ geschaffen wurden.
Einen wunderbaren „Reisebericht“ hat Simone Pedrini verfasst und auf den Seiten von INSR veröffentlicht: englisch / deutsch.
März 2018: Die Stiftung Mensch und Umwelt hat wieder einen bundesweiten Pflanzwettbewerb unter dem Motto „Wir tun etwas für Bienen“ aufgelegt.
Prämiert werden neu bepflanzte oder mit Strukturen wie Lesesteinhaufen, Trockenmauern, Sandlinsen, Totholzhaufen und geeigneten Nisthilfen für Wildbienen aufgewertete Flächen.
Registrierte Wettbewerbsteilnehmer können stark rabattiertes Wildpflanzensaatgut erhalten.
08.11.2017: Neue Fassung des Regelwerks für VWW-Regiogehölze® online
Die aktuelle Fassung finden Sie hier.
06.11.2017: Native Seed Conference at Kew Gardens – Abschlusskonferenz des NASSTEC-Projektes. Vom 25. bis 29. September 2017 hat die Abschlusskonferenz des NASSTEC-Projektes unter Beteiligung vieler Wildpflanzensaatgutproduzenten aus aller Welt in London stattgefunden. Hier finden Sie unseren Bericht zur Tagung.
04.10.2017: Fördermöglichkeiten bei der Anlage von Bienenblühflächen in Hessen
Die hessische Umweltlotterie GENAU vergibt wöchentlich 5.000,- Euro für ein Umwelt- und Naturschutzprojekt, wie zum Beispiel die Anlage bestäuberfreundlicher Blühflächen. Diese Mittel können von Vereinen, Kirchen, Schulen und Kindergärten direkt bei der Ministerin oder über die Umweltlotterie Hessen beantragt werden. Weitere Infos hier.
September 2017: Liste der angebauten Arten 2016 jetzt verfügbar
Die Artenliste 2016 finden Sie hier.
30.08.2017: Fernsehbeitrag Wildblumenretter und Schmetterlingsfreund
Das NDR-Fernsehen berichtet über die Bemühungen bunte Wiesen und den Goldenen Scheckenfalter nach Schleswig Holstein zurückzuholen und stellt dabei die Arbeit der Arche Gärtnerei in Eggebek und das Projekt BlütenMeer 2020 vor
vom 25. bis 29. September 2017 findet bei Kew Gardens in London die Abschlusskoferenz „SEED QUALITY OF NATIVE SPECIES: ecology, production & policy“ des von der EU geförderte NASSTEC-Projektes statt, welches sich mit der Produktion von heimischen Saatgut für die Renaturierung von Grünland beschäftigt.
Der VWW wir dort mit einem Vortrag über die Zertifizierung von regionalen Wildpflanzen in Deutschland vertreten sein.
Für Interessierte: Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos und eine Anmeldung bis zum 31.07.2017 unter folgendem Link möglich: https://nasstec.eu/conference/register
Auf der Website des Projekts finden sich alle weiteren Informationen zu Tagung.
Seit Mai 2016 : Das gemeinsam mit der Agroisolab GmbH eingereichte Forschungsprojekt „Aufbau einer Herkunftsdatenbank für Wildpflanzensaatgut krautiger Pflanzen und Entwicklung eines analysebasierten Rückverfolgbarkeitssystems“ hat ab dem 17.05.2017 eine Förderzusage von der DBU erhalten und wird jetzt für zwei Jahre finanziell unterstützt. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.
Am 31.03.2017 findet die 4. CAMPUSKONFERENZ LANDSCHAFTSENTWICKLUNG MIT DEM THEMA „RENATURIERUNG IN DER LANDSCHAFTSENTWICKLUNG – AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN“ statt.
Beginn: 9:30 Uhr
Ort: Hochschule Osnabrück, Campus Haste, Raum HR 05/06
Kosten: 25€/5€ ermäßigt für Studierende.
Eine Anmeldung wird ab Mitte Januar über die Homepage der Landschaftsentwicklung möglich sein
https://www.hs-osnabrueck.de/de/studium/studienangebot/bachelor/landschaftsentwicklung-beng/#c999654
Am 11.09.2015 bitten wir in einem Brief das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die bisherige Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV) zu überdenken, da die Regelung mit 22 Ursprungsgebieten nicht dem Saatgutangebot auf dem deutschen Markt entspricht. Wir schlagen vor, die Definition der Ursprungsgebiete in der ErMiV zu reduzieren, ohne das Konzept einer kleinteiligen Regionengliederung insgesamt aufzugeben. In dem folgenden Anhörungsverfahren trifft unser Anliegen bei einigen Beteiligten auf Unverständnis, da es den Anschein hat, als wollte der VWW die kleinräumige Gliederung mit 22 Regionen aufgeben und so dem Naturschutz schaden.
01.06.2015: Der Artikel: „Wildpflanzensaatgut im Spannungsfeld des Naturschutzes“ mit kritischen Anmerkungen zum aktuellen Regelwerk FLL-Regio von Markus Wieden erscheint in NuL 47 (6), 2015, S. 181-190 (Artikel als pdf)
März 2015:
Baumschulen gesucht, die gebietseigene Gehölze gemäß VWW-Regiogehölze® erzeugen!
Regelmäßig erreichen uns Anfragen, wo man regionale Gehölze beziehen kann. Bisher können wir da auf unsere Mitgliedsbetriebe in Sachsen verweisen, würden die verfügbaren Vorkommensgebiete aber gerne ausweiten. Bitte informieren Sie sich hier zu den erforderlichen Voraussetzungen und den Kosten der Gehölzzertifizierung. Oder rufen Sie uns an!
01.02.2015:
Seit Frühjahr 2014 gibt die FLL ein Regelwerk („Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“) heraus, das den Anspruch erhebt, für ganz Deutschland Mischungen zu beschreiben, die als Mindeststandard für Begrünungen in der freien Natur für fast alle Standorte geeignet sind.
Der VWW hält diese Mischungen für nicht geeignet, einen Mindeststandard zu erfüllen. Die FLL-Mischungen werden nach nun einem Jahr Praxis über den ihnen zugedachten Zweck hinaus in naturschutzfachlich anspruchsvollen Bereichen eingesetzt, obwohl hier regional abgestimmte, individuelle Mischungen weitaus zielführender sind. Um dieser massiven Fehlentwicklung zu begegnen, weist der VWW im Detail auf die Schwachstellen des FLL-Regelwerks hin.
1.11.2014 Bis auf Weiteres ist die Karte mit den genauen naturräumlichen Grenzlinen im Maßstab 1:25.000 beim Bundesamt für Naturschutz nicht mehr online. An einer Neueinstellung der Seite wird nach Angaben des BfN gearbeitet.
1.2.2014 Seit dem 1. Februar bietet der VWW eine Liste aller aktuell angebauten Wildformen von Kräutern und Gräsern an, die nach dem VWW-Standard „VWW-Regiosaaten®“ zertifiziert sind. Die Liste enthält bundesweit alle Landkreise, Regionen und Produktionsräume, in denen Anbau stattfindet und ist für Anwender mit Sortierfunktionen ausgestattet.
Am 09.01.2014 wurde nun endlich die letzte (geplante) Änderung der Erhaltungsmischungsverordnung vollzogen. Der neue §6 beschränkt die handelbare Menge von Arten, die im SaatG geregelt sind, wie folgt:
„§6(1) Das Bundessortenamt setzt die Höchstmenge des in Erhaltungsmischungen in den Verkehr gebrachten Saatgutes von Arten, die unter die Richtlinie 66/401/EWG in der jeweils geltenden Fassung fallen, derart fest, dass die festgesetzte Höchstmenge 5 vom Hundert des Gesamtgewichtes aller Saatgutmischungen, die im Rahmen der Richtlinie 66/401/EWG in der jeweils geltenden Fassung im Inland jährlich in den Verkehr gebracht werden, nicht übersteigt.“
Die 5% dürften allerdings in den nächsten Jahren nicht erreicht werden, so dass hier zunächst kein Handlungsbedarf entsteht. Die geänderte Verordnung schreibt zudem vor, die geplanten Verkaufsmengen vorab anzumelden und auch am Jahresende die tatsächliche Menge zu melden. Dies gilt übrigens auch für Wiesendrusch-Ware.
Online ist die Verordnung im Bundesgesetzblatt unter Artikel 4 zu finden.
Am 15.10.2013 findet eine Tagung zum Thema „Naturnahe Begrünung im Offenland“ der Naturschutzakademie Hessen in Lollar statt. Markus Wieden berichtet über „Naturnahe Grünlandanlagen mit Gebietsheimischem Saatgut“. Nährere Infos unter: offenlandinfo
19.9.2013 Mehrere Baumschulen konnten in diesem Monat erstmalig das Audit von ABCert zum neuen Zertifikat VWW-Regiogehölze erfolgreich durchlaufen. Ab sofort stehen damit zertifizierte Gehölze nach dem neuen VWW-Regelwerk auf dem Markt zur Verfügung.
06.06.2013 Seminar: „Wildpflanzen aus der Region – Produktion und Einsatzbereiche“
Am 6. Juni 2013 veranstaltet das Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein ein Seminar zu diesem Thema. Unser Mitglied Gisela Twenhöven wird hier zu den Einsatzmöglichkeiten von Wildpflanzen im kommunalen Bereich referieren. Das Seminar beginnt um 9:00 Uhr und findet in Jerrishoe bei Flensburg statt.
17.5.2013 Auf der Mitgliederversammlung des VWW in Sachsen wurden weitreichende Neuerungen beschlossen. So bietet der VWW ab sofort eine Zertifizierung von Gehölzen für Baumschulen und Sämlingsvermehrer an. Das bestehende Gräser-Kräuter-Zertifikat wurde aktualisiert. Die Mitgliedsbeiträge wurden an die steigenden Mitgliederzahlen unter Einbeziehung des Saatguthandels angepasst. Kleinere Betriebe werden dabei entlastet.
Seit dem 8.11.2012 gilt eine modifizierte Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV; BGBl.I S. 2270, Nr. 52). Im § 4 wurde die erwartete Ausweitung der Handelbarkeit auf die Nachbarregion bis 2020 eingefügt. Dies stellt zwar eine gewisse Verbesserung dar, führt aber in Gebieten ohne eigene oder nachbarliche Saatgutproduktion zu völligem Fehlen von Alternativen (sieht man einmal von den häufig nicht verfügbaren Mähgutübertragungen ab).
§ 5 beschreibt ausführlich die Möglichkeit, private Zertifizierungsunternehmen in die Qualitätssicherung einzubeziehen. Hier wird die Handhabung der Länderanerkennungsstellen die entscheidenden Weichen für unsere zukünftige Arbeit stellen. Den vollständigen Verordnungstext finden Sie z.B. unter: http://www.buzer.de/gesetz/10351/a178141.htm
17.9.2012: In der September/Oktober-Ausgabe von Natur und Landschaft hat der VWW einen Artikel unter der Rubrik „Natur und Recht“ veröffentlicht. Darin wird das neue Saatgutrecht besprochen und Hinweise zur Verfügbarkeit innerhalb des deutschen Regionenmodells sowie zur Qualität und Zertifizierung gegeben.
7.8.2012: Als erster Betrieb im VWW erhielt die Fa. Rieger-Hofmann am 7. August die Genehmigung zum Inverkehrbringen von Erhaltungsmischungen nach §3.1 der neuen Erhaltungsmischungsverordnung. Die Genehmigung wurde von der Saatgutanerkennungsstelle des Landes Baden-Württemberg ausgestellt. Ähnliche Bescheide dürften in den nächsten Monaten für weitere Mitgliedsbetriebe überall in Deutschland ausgestellt werden. Damit sind erstmals Wildformen wichtiger Grünlandarten nicht nur nach dem Naturschutzrecht sondern auch nach dem Saatgutverkehrsgesetz legal erhältlich. Im VWW sind damit beispielsweise zertifizierte Wildformen von Hornklee (Lotus corniculatus), Gelbklee (Medicago lupulina), Rotklee (Trifolium pratense), Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Deutschem Weidelgras (Lolium perenne), Wiesenschwingel (Festuca pratensis), Rotschwingel (Festuca nigrescens), Schafschwingel (Festuca guestfalica), Schmalblättriger Wiesenrispe (Poa angustifolia), Gewöhnlicher Wiesenrispe (Poa pratensis) und Goldhafer (Trisetum flavescens) verfügbar.
29.2.2012: Der erste Teil der Erhaltungsmischungsverordnung (Umsetzung der EU-Richtlinie 2010/60) ist in Kraft. Er findet sich unter http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ermiv/gesamt.pdf.
Weitere Teile der neuen Saatgut-Regelung werden aus formalen Gründen voraussichtlich erst im März/April verabschiedet. Bis dahin ist die Verordnung noch unvollständig.
10. Jan. 2012: Das Bundesumweltministerium hat einen neuen „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze herausgegeben (online unter: http://www.bmub.bund.de/service/publikationen/downloads/details/artikel/bmu-leitfaden-zur-verwendung-gebietseigener-gehoelze/). Er beschreibt die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe und eines Forschungsvorhabens. Der Leitfaden hat nur empfehlenden Charakter, bietet aber auch für Gräser- und Kräuter interessante Aspekte vor dem Hintergrund des novellierten BNatschG.
Wesentliche Inhalte sind die Beschreibung von 6 Vorkommensgebieten, innerhalb derer an naturnahen Standorten (mind. 50 Jahre alte Bestände) gesammelt und das Vermehrungsgut auch wieder ausgebracht werden muss. Die 6 Vorkommensgebiete sind im Vergleich zu 8 Produktionsräumen bei Kräutern und Gräsern mit Rücksicht auf die schwierige Vermehrungspraxis gewählt worden. Allerdings dürfen auch außerhalb eines Vorkommensgebietes Vermehrungsschritte erfolgen.
Wichtig erscheinen die Hinweise zum Einsatzbereich „freie Landschaft“, nach denen auch Straßenbegleitgrün gebietseigen angelegt werden muss; ausgenommen sind unmittelbarer Straßenseitenraum und Mittelstreifen. Zu beachten sind, nach Bundesländern unterschiedlich, die Regelungen für das Forstvermehrungsgutgesetz bei den dort genannten Baumarten. Ausführliche Hinweise zur Ausschreibungspraxis und Empfehlungen zur lückenlosen Nachweispflicht aller Gewinnungsschritte (bzw. zur privaten Zertifizierung) ergänzen den Leitfaden.
Am 16.11.2011 findet im Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume in Flintbek (Tel: 04347 704-787) ein Seminar statt. Thema: Entwicklung von artenreichen Offenlandlebensräumen – Wissens- und Erfahrungsaustausch. Neben vielen anderen interessanten Beiträgen gibt es einen Vortrag von Johann Krimmer: Anreicherungen von Niedermoorwiesen mit gebietsheimischen Gräsern und Kräutern – Erfahrungen eines Landwirts aus Bayern.
Am 11.11.2011 findet in der Hochschule Osnabrück im Rahmen der Osnabrücker Kontaktstudientage eine Tagung mit dem Thema „Naturnahe Begrünungsverfahren – wissenschaftlicher Hintergrund und praktische Anwendung“ statt. Redner sind u.a. Sabine Tischew, Ernst Rieger, Silke Lütt, Anita Kirmer, Sigurd Henne.
6.11.2011 um 11 Uhr gibt es im Botanischen Garten Hamburg einen Vortrag von Gisela Twenhöven zum Thema: Blühmischungen mit standortgerechten Arten.
17.10.2011: Die nationale Umsetzung der EU-Richtlinie 2010/60 mit der Erlaubnis des Inverkehrbringens von Wildsaatgutarten, die dem Saatgutverkehrsgesetz unterliegen, ist vorbereitet. Ein erster abgestimmter Entwurf einer entsprechenden Verordnung steht und wird vermutlich Anfang November 2011 dem Bundesrat vorgelegt. Der VWW konnte an dieser Richtlinie in vielen Punkten mitwirken.
12.9.2011: Im September 2011 ist ein ausführlicher Beitrag zur Wiedereinrichtung artenreichen Grünlands mit Hilfe von Ansaaten bzw. Mähgutübertragung erschienen. Darin fließen Ergebnisse aus einem internationalen Forschungsvorhaben mit zahlreichen Versuchsstandorten ein. Quellenangabe: Krautzer et al. (2011): Establishment and use of High Nature Value Farmland.- in Grassland Farming and Land Management Systems in Mountainious Regions.- Proceedings of the 16.th Symposium of the Europaean Grassland Federation (EGF), Gumpenstein, Austria, 29.-31.8.2011; Hrsg.. Pötsch, E.M.; Krautzer, B.; Hopkins, A.; Grassland Science in Europe, Bd.16 (632 Seiten, s/w).
Am 11. bis 12. Mai 2011 findet in Landshut bei der ANL eine wichtige Tagung zur Begrünung mit Wildpflanzen statt. René Schubert, DVL-Koordinierungsstelle Sachsen, referiert über: „Gebietsheimisches Saat- und Pflanzgut und das neue Bundesnaturschutzgesetz – Entwicklungen in Bund und Ländern.“
24.02.2011 Seminar in der Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz (NNA)in Schneverdingen: Naturschutzfachliche Aufwertungen von Grünlandkomplexen. Vortrag von Frau Gisela Twenhöven um 13.30: Erzeugung und Einsatz von Regiosaatgut – Möglichkeiten der Aufwertung von Grünland.
Deutscher Landschaftspflegetag in Sachsen vom 23.9 bis 25.9.2010
Ort: Hotel Kloster Nimbschen
Landstr. 1, 04668 Grimma, Anmeldung unter Tel.: 0981-4653 3540
Die folgenden Vorträge beschreiben das Netzwerk aus Wildpflanzenanbau und dem koordinierenden Fachprojekt im DVL-Landesbüro Sachsen, das den Kurzschluss zu ausschreibenden Stellen, bewilligenden Naturschutzbehörden und potenziellen Anwendern herstellt.
Innerartliche Vielfalt ist gefragt –
Kompetenznetzwerk für gebietsheimisches Saat- und Pflanzgut in Sachsen
René Schubert, DVL-Koordinierungsstelle Sachsen
Vermehrung mit Herz und Verstand – Wildsaatenanbau in der Praxis
Betriebspartnerschaft Margot Franck und Gert Harz, Lommatzsch
Die Ergebnisse der Tagung können in Kürze auf der Homepage des DVL-Landesverbandes Sachsen unter sachsen.lpv.de eingesehen werden.
25.6.2010 Neue EU-Richtlinie: Der ständige Saatgutausschuß der EU hat nach jahrelangen Beratungen dem Kommissionsvorschlag für eine neue Richtlinie zugestimmt. Damit wird erstmalig der Handel mit Wildpflanzenmischungen, die Futterpflanzen im Sinne der Futterpflanzenrichtlinie enthalten (einige angemeldete Sorten nach dem Saatgutverkehrsgesetz, z.B. Rotschwingel, Rotklee) geregelt. Als besonders gekennzeichnetes Material darf Wildpflanzensaatgut mit 5% der Menge des gesamten gehandelten Begrünungssaatguts gehandelt bzw. produziert werden. Gegenüber früheren Entwürfen der Richtlinie ist der Nachbau von Wildformen nicht mehr an die Region gebunden, in der gesammelt wurde. Diese nach Auffassung des VWW bedenkliche Freigabe soll in Deutschland nach Auskunft des Verbraucherschutzministeriums (BMELV) strenger gefasst werden. Die Veröffentlichung der verabschiedeten EU-Richtlinie und die Umsetzung in nationales Recht wird sich insgesamt noch bis 30.11.2011 erstrecken.
Am 25.06.2010 hat sich im Bundesumweltministerium (BMU) eine Arbeitsgruppe „gebietsheimische Gehölze“ gegründet, die aus Vertretern mehrerer Länderministerien und Verbänden besteht. Die Arbeitsgruppe möchte Grundlagen dafür schaffen, die 10jährige Übergangsfrist nach §40(4) BNatSchG effektiv im Sinne des Naturschutzes und der Baumschulwirtschaft zu nutzen. Der DVL (Deutscher Verband für Landschaftspflege) als Mitglied der Arbeitsgruppe erläuterte die aktuellen Regelungen zu Herkunfts- und Produktionsgebieten bei regionalem Saatgut, was den Vertretern der Gehölzbranche als Machbarkeits-Vorbild diente. Gebietsheimische Bäume und Sträucher werden im Unterschied zum Saatgut jedoch lediglich 9 deutschen Herkunftsgebieten zugeordnet, und eine Anzucht ist unabhängig vom Herkunftsgebiet überall erlaubt. Der DVL betonte im BMU, dass eine solche von Regionen unabhängige Vermehrung für Gräser und Kräuter fachlich völlig inakzeptabel ist.
Am 11. Mai findet in der Naturschutzakademie in Laufen in Oberbayern eine Tagung zum Thema „Vielfalt durch Begrünung“ statt. Johann Krimmer (VWW) berichtet aus seiner langjährigen Praxis unter dem Titel: Von der Wildpflanze zur Saatgutmischung – Material für anspruchsvolle Begrüngungsprojekte.
Ab 1. März 2010 gilt das neue Bundesnaturschutzgesetz. Gleich zwei Paragraphen berücksichtigen direkt und zum ersten Mal unsere Anliegen. §39 zeigt, dass der Gesetzgeber generell die Vermehrung und das Angebot von regionalem Saatgut befürwortet. Entnahmegenehmigungen können über diesen Hinweis vielleicht in Zukunft leichter erteilt werden und die noch häufig diskutierte Frage, ob regionales Saatgut eine sinnvolle Naturschutz-Maßnahme sein kann, bekommt über das BNatschG eine positive Antwort.
§40 schafft einen Übergangszeitraum für die Ausbringung nicht gebietseigener Pflanzen bis 2020. Allerdings darf auch in dieser Zeit nur dann gebietsfremdes Saat- und Pflanzgut ausgebracht werden, wenn kein regionales Material verfügbar ist; so, zumindest, kann das Wörtchen „vorzugsweise“ juristisch verstanden werden.
Im Folgenden der Wortlaut der relevanten Passagen:
§39 (4) Das gewerbsmäßige Entnehmen, Be- oder Verarbeiten wild lebender Pflanzen bedarf unbeschadet der Rechte der Eigentümer und sonstiger Nutzungsberechtigter der Genehmigung der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Bestand der betreffenden Art am Ort der Entnahme nicht gefährdet und der Naturhaushalt nicht erheblich beeinträchtigt werden. Die Entnahme hat pfleglich zu erfolgen. Bei der Entscheidung über Entnahmen zu Zwecken der Produktion regionalen Saatguts sind die günstigen Auswirkungen auf die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.
§40 (4) Das Ausbringen von Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien Natur sowie von Tieren bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde. Künstlich vermehrte Pflanzen sind nicht gebietsfremd, wenn sie ihren genetischen Ursprung in dem betreffenden Gebiet haben. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn eine Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten der Mitgliedstaaten nicht auszuschließen ist. Von dem Erfordernis einer Genehmigung sind ausgenommen
- der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft,
- der Einsatz von Tieren
- nicht gebietsfremder Arten,
- gebietsfremder Arten, sofern der Einsatz einer pflanzenschutzrechtlichen Genehmigung bedarf, bei der die Belange des Artenschutzes berücksichtigt sind, zum Zweck des biologischen Pflanzenschutzes,
- das Ansiedeln von Tieren nicht gebietsfremder Arten, die dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen,
- das Ausbringen von Gehölzen und Saatgut außerhalb ihrer Vorkommensgebiete bis einschließlich 1. März 2020; bis zu diesem Zeitpunkt sollen in der freien Natur Gehölze und Saatgut vorzugsweise nur innerhalb ihrer Vorkommensgebiete ausgebracht werden.
Am 20. Januar 2009 wurde im Rahmen des DBU-Projekts zu gebietseigenem Saatgut ein abgestimmter Vorschlag für eine Gliederung Deutschlands in Wildsaatgut-Regionen an alle Beteiligten verschickt.
Am 12.März 2008 traf sich zum ersten Mal in Esslingen eine unabhängige Kommission zur Vergabe des Zertifikates. Neben umfangreichen Regularien zur konstituierenden Sitzung, wie Verabschiedung einer Geschäftsordnung, Wahl eines Vorsitzenden und Übernahme der Prüfungsdaten von ABCert, wurden auch erstmals für vier Wildsaatgut-Vermehrungsbetriebe in Deutschland Zertifikate ausgestellt. Die Produzenten und Händler werden unter anderem auf Plausibilität zwischen Erträgen und Anbauflächen, Mengentreue zwischen Zukauf und Verkauf sowie auf die Qualität der Ware geprüft. Einzelheiten zur Zertifizierung finden Sie hier.

- Die Anerkennungskommission bei Ihrem Gründungstreffen in Esslingen. (Foto: K. Weiß, 2008)
Zum Jahreswechsel 2007/2008 wurde der Uni Hannover von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ein Forschungsprojekt bewilligt, das der VWW als beratender Partner unterstützt. Das Projekt soll für 18 Regionen in Deutschland naturschutzfachliche Vorgaben für die Ausbringung von Wildpflanzensaat- und Pflanzgut erarbeiten.
zu den neuesten Nachrichten